Im Alter von gerade mal 25 Jahren wurde Stephan Dorschner im Mai 1990 zum ersten Jugenddezernent der Stadt gewählt – und half in der Zeit als Lokalpolitiker dem Kassablanca bei der langjährigen mühseligen Suche nach einem eigenen Domizil. Im Interview erzählt er, wie es war, ohne jegliche politische Erfahrung nach der Wende die Jugendarbeit aufzubauen, mit Hausbesetzern und der Polizei zu verhandeln, rechtsfreie Räume zu nutzen und Fördertöpfe anzuzapfen. Heute ist er Professor für Theorie und Praxis der Pflege an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena.
Wie kam es, dass Sie 1989/90 als jüngster Teilnehmer mit am Runden Tisch im Jenaer Rathaus saßen? Gehörten Sie zur Oppositionsbewegung?
Das kam durch meine Aktivitäten in der katholischen Kirche. Innerhalb der Gemeinde hatte sich zu Wendezeiten der Arbeitskreis Kirche und Gesellschaft gebildet. Als die Stadt die Parteien aufrief, zu einem Runden Tisch zusammenzukommen, habe ich einen Brief dorthin geschrieben, weil ich fand unser Arbeitskreis sollte auch mit dabei sein. Ich weiß gar nicht mehr, wer am Ende die Einladungen ausgesprochen hat. Aber ich saß mit dran.
Zu DDR-Zeiten waren Sie also schon in der katholischen Gemeinde in Jena aktiv?
Meine Familie war katholisch. Und Religionsunterricht gab es zu DDR-Zeiten ja nicht an den Schulen, sondern nur in den Kirchen. In Jena gab es nicht viele Katholiken, dadurch kamen alle Kinder und Jugendlichen aus katholischen Familien in einer Gemeinde zusammen. Da gab es Veranstaltungen, Vorträge, Feiern. Die Katholische Jugend war meine Heimat. Das hatte viel damit zu tun, dass kirchliche Jugendarbeit auch eine der wenigen Möglichkeiten war, sich außerhalb des Systems zu organisieren.

Wie normal war das? Gab das keinen Ärger?
Normal war das nicht. Ich bewarb mich nach dem Abitur für ein Studium der Medizintechnik und bekam eine Ablehnung. In meinem Zeugnis stand, dass ich „Probleme nicht weltanschaulich im Sinne des Marxismus-Leninismus“ durchdringen würde. „Deshalb kann Stephan nicht aktiv auf die politische Meinungsbildung des Klassenkollektivs einwirken.“ Damit war mein kirchlicher Hintergrund gemeint.
Was haben Sie dann gemacht?
Erstmal habe ich als Hilfspfleger am jetzigen Uni-Klinikum in Jena gearbeitet und später eine ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Zur Wendezeit war ich Lehrer für Pflegeberufe am Katholischen Krankenhaus in Erfurt und machte nebenbei ein Fernstudium Medizinpädagogik an der Martin-Luther-Universität Halle.
Meine Chefin in Erfurt war eine Ordensschwester. Als einziger Mann an der Schule hatte ich für die technischen Dinge die Verantwortung. Unter anderem für ein Ormig-Gerät mit Handkurbel. Damit habe ich dann zu Wendezeiten immer wieder Flugblätter produziert, vor allem für den Demokratischen Aufbruch.
Und so begann das dann praktisch mit Ihrer Oppositionstätigkeit?
Wie bei vielen waren das eher kleine Sachen, die sich zufällig ergaben. Eine der ersten Aktionen, die wir mit dem katholischen Arbeitskreis machten, war zum Beispiel ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Jena, wo man Kriegsspielzeug gegen anderes Spielzeug umtauschen konnte.
Was hat Sie dann dazu bewogen, bei den Kommunalwahlen anzutreten?
Die vorhandenen und die neugegründeten Parteien und Bündnisse mussten ja sehr zügig ihre Listen für die Kommunalwahl im Mai 1990 erstellen. Der Demokratische Aufbruch hatte eine Liste zusammen mit der CDU. Und so wurde auch ich gefragt, wie andere aus dem katholischen Arbeitskreis, ob ich kandidieren möchte. Vor der Anfrage hatte ich mich damit nicht beschäftigt. Und aus meinem Arbeitskreis war ich auch der einzige, der Ja gesagt hat.
Warum haben Sie Ja gesagt?
Ich dachte einfach, man kann nicht nur reden und fordern und in irgendwelchen Runden sitzen, sondern muss auch selbst Verantwortung übernehmen.
Der Demokratische Aufbruch war eine ganz neue Partei, die sich im Oktober 1989 in Leipzig gründete. Wieso waren Sie gerade für die aktiv?
Vieles hat sich damals zufällig ergeben. Man hat ja Leute teilweise erst bei den Demos auf der Straße kennengelernt. Politisch fühlte ich mich einfach am ehesten zum Demokratischen Aufbruch hingezogen. Auf deren Liste habe ich dennoch als Parteiloser kandidiert, ich bin dann erst viel später Mitglied der CDU geworden.
Erst sind Sie 1990 eher so zufällig zum Stadtrat gewählt worden. Und dann sind Sie direkt auch noch zu einem von elf Dezernenten ernannt worden, also zum Leiter eines ganzen Geschäftsbereiches und damit hauptamtlichen Politiker. Wie kam das?
Diejenige, die eigentlich den Posten der Jugenddezernentin übernehmen sollte, entschied sich kurzfristig, doch lieber eine akademische Karriere an der Universität einzuschlagen, statt hauptberuflich in die Politik zu gehen. Dadurch wurde ich dann gefragt. Ich hatte ein Wochenende, um zu überlegen, ob ich das machen will. Der Vorteil, wenn man noch jung ist: Man entscheidet sich schneller.
Die bei den ersten freien Kommunalwahlen gewählten 93 Stadtverordneten wählten am Dienstag, 6. Mai 1990 im Volkshaus den Tierarzt Dr. Peter Röhlinger zum Oberbürgermeister. Anschließend wurden zwei stellvertretende Bürgermeister und elf Dezernenten (auch Beigeordnete genannt) in Blockwahl gewählt. Allgemeine Verwaltung: Ulrich Boock (Neues Forum), Finanzen: Ulrich Holzgräbe (SPD), Rechtssicherheit und Ordnung: Holger Migula (CDU/DA), Kultur: Klaus Hattenbach (SPD); Familie, Jugend, Freizeit, Sport: Stephan Dorschner (CDU/DA); Gesundheit und Soziales: Rolf Fricke (NF); Bauwesen: Peter Schulz (SPD); Handel und Gewerbe: Peter Probandt (FDP); Umwelt: Matthias Mann (GL); Wirtschaft und Verkehr: Christoph Schwind (CDU/DA), Wissenschaft und Bildung: Frank Schenker (CDU/DA).
Ein junger Jugenddezernent, das ist doch super. Mit 25 wären Sie ja auch noch als Gast im Kassablanca durchgegangen.
Naja, ich war eher nicht so der regelmäßige Kassablanca-Gast.
Wieso?
Das war nicht so ganz meine Richtung. Und ich hatte auch gar keine Zeit, denn meine Kinder waren damals noch sehr klein. Die hab ich morgens mit dem Trabant in den Kindergarten gebracht und dann bin ich in mein Büro im Stadthaus am Roten Turm gefahren.
Wo heute das Einwohnermeldeamt ist?
Genau. Zu DDR-Zeiten war in dem Gebäude der Stadtratsbereich JKS untergebracht – Jugendfragen, Körperkultur, Sport. Das hieß in jeder Stadt so, es gab ja für alles Einheitsbezeichnungen in der DDR. Wobei ich nie verstanden haben, was der Unterschied zwischen Körperkultur und Sport ist.
Nach der Wende hieß Ihr Dezernat „Familie, Jugend, Freizeit und Sport“. Klingt nach viel. Das Kassa, das sich damals gerade erst gründete, war doch bestimmt eher Nebensache für Sie?
Es war tatsächlich nur eine Aufgabe von sehr vielen. Sie müssen die Zeit verstehen. Im Mai 1990 habe ich einen Bereich mit fünf Mitarbeitern vorgefunden. 1993 waren es dann etwa 1.300. Zwischendurch waren es sogar mal mehr als 2.000. Zu DDR-Zeiten gehörte kaum etwas zum Bereich JKS. Es gab kein Jugendamt, nur ein Referat Jugendhilfe. Städtische Jugendklubs gab es nur drei und dem Kulturbereich angegliedert, die anderen waren betriebliche Jugendclubs, von denen die meisten nach der Wende mit ihren Betrieben verschwanden. Die Kinderkrippen gehörten in der DDR zum Bereich Soziales. Und die Kindergärten gehörten zum Bereich Volksbildung und wurden dann ebenfalls zu meinem Feld. All diese Aufgaben sind erst nach und nach meinem Dezernat zugeordnet worden, dazu brauchte es jedes Mal einen Magistratsbeschluss.
In einem Zeitungsartikel aus dem Sommer 1994 wird Kassa-Mitgründer Alf-K. Heinecke damit zitiert, dass Sie mit “privatem und riskanten Einsatz” für das Projekt gekämpft hätten. Was meinte er damit?
Vielleicht spielt das auf die Anfangszeit des Kassa im Villengang an, wo es Auseinandersetzungen gab mit Rechtsextremen. Da habe ich als Jugenddezernent immer wieder das Gespräch gesucht, wie auch im Zusammenhang mit der Hausbesetzung am Westbahnhof.

Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv 
Kassablanca Archiv
Auch in dem besetzten Haus in der Karl-Liebknecht-Straße, von dem Ingrid Sebastian (erst Hausbesetzerin, später Sozialarbeiterin im Kassa, C.G.) erzählt, war ich zu Besuch – und hatte dort, auch wenn es bitter war, den Jugendlichen vor jenem ersten Tag der Einheit 1991, an dem es zu einem Überfall durch Neonazis kam, geraten, das Haus zu verlassen, es nicht drauf ankommen zu lassen. Das hatte sich auch als richtig erwiesen. Es waren viele sehr schwierige Situationen, anstrengende Gespräche. Keiner von uns frisch gebackenen Behördenvertretern hatte gelernt mit der Polizei zu verhandeln und mit Hausbesetzern und Hauseigentümern. Jeder hatte seine eigenen Interessen und wollte verstanden werden.
Auf einem Zeitungsfoto, das an jenem Wochenende im Mai ’94 entstanden ist, sieht man Sie vor dem besetzten Haus in der Felsenkellerstraße sitzen und mit Jugendlichen diskutieren.
Ich finde das interessant, denn ich hatte das schon vergessen und es ist mir erst jetzt durch dieses Foto wieder eingefallen. Hier fanden wir den Kompromiss, dass die Jugendlichen erstmal das Gebäude wieder räumen bis zum nächsten Morgen. Und im Gegenzug wurde der Strafantrag wegen Hausfriedensbruch fallen gelassen, und die Polizei, die das Gebäude räumen wollte, rückte wieder ab.
Das Haus war am 17. Mai 1994 von 25 bis 50 Jugendlichen besetzt worden, von denen sich viele schon seit Jahren vergeblich bemühten, ein Domizil für ihren Verein „Unabhängiges Jugendzentrum“ zu finden. Zuvor hatten sie schon ein besetztes Haus in der Brandströmstraße räumen müssen.
Wir versprachen den Jugendlichen, dass es eine Nutzungsvereinbarung geben wird und sie in das Gebäude zurückkehren dürfen. Daran haben wir uns gehalten. Manche wohnen ja bis heute in dem Gebäude. Diese Situation so lösen zu können, hat mich persönlich sehr gefreut. Das waren ja auch immer solche Aktionen, wo man einen Anruf kriegt, schnell irgendwo hinfährt und nicht weiß, wann man wieder nach Hause kommt. Wo man also auch die eigene Familie dann immer hinten anstellt.

Was hat ihre Tätigkeit als Jugenddezernent genau ausgemacht und wie hat sie sich verändert?
Die Kinder- und Jugendhilfe, so wie sie in der Bundesrepublik strukturiert und organisiert war, ist überhaupt nicht zu vergleichen gewesen mit dem, wie es in der DDR war. Nach der Wende galt das bundesdeutsche Jugend- und Kinderschutzgesetz auch für uns. Das war alles komplett neu. So mancher DDR-Bürger hatte dann auch das Gefühl, dass den neuen Ländern da etwas übergestülpt wurde.
Thomas „Kaktus“ Grund, der lange Sozialarbeiter in Jena war, und zu DDR-Zeiten in der JG Stadtmitte offene Jugendarbeit machte, hat mal geschrieben: „1991 kam dann durch Frau Merkel das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz, welches mir der Amtsleiter mit der Bemerkung in die Hand gab, das sei jetzt unsere neue Bibel. Damit war endlich legitimiert, was wir fast 20 Jahre unter großen Schwierigkeiten und Beargwöhnung schon taten. Mit diesem Gesetz bekam jeder Jugendliche das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, gleichberechtigten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“
Abgesehen von der kirchlichen Jugendarbeit hatten wir Null Infrastruktur im Osten. Offene Jugendarbeit, wie es das Kassa später machen sollte, gab es offiziell nicht. Wir haben erstmal das Jugendamt aufgebaut und einen Jugendhilfeausschuss gegründet, und damit gab es dann schon mal ein Gremium, in dem potenzielle Träger oder freie Träger für die Jugendarbeit zusammen kommen konnten.
Das war ja auch so eine Neuheit. Die freie Trägerschaft als Konzept war im Osten praktisch nicht vorhanden gewesen. Da hat uns die Erfahrung gefehlt und vor allem die freien Träger, in den Alten Bundesländer waren das überwiegend etablierte und mächtige Wohlfahrtsverbände. Das Kassablanca ist so ein Beispiel, die das selbst umgesetzt haben, wo sich junge Menschen gefunden und gesagt haben, wir wollen etwas tun und zwar auch unabhängig von etablierten Strukturen.
Was waren denn so Situationen, wo man das Gefühl hatte, das Gesetz sei den Neuen Ländern übergestülpt worden?
Man musste sich auf die neuen Strukturen einlassen. Die waren aber eigentlich für die alte Bundesrepublik gemacht und galten über den Einigungsvertrag sofort auch für uns. Damit ist eine Situation entstanden, wo man schauen musste: Wir haben ein Gesetz, das ist gar nicht für uns gemacht, aber wir müssen es jetzt anwenden. Man musste halt viel lernen. Ich wusste ja auch nicht wie Verwaltung in der Bundesrepublik funktioniert, oder föderale Strukturen.
Generell mussten also erstmal Strukturen geschaffen werden.
Das ging in den Jahren ’90 bis ’94 noch gut, zumindest in Jena. Neu anfangen zu können, oder zu müssen, ist natürlich immer auch eine Chance. Vielleicht waren hier auch die Rahmenbedingungen besser als in anderen Städten Ostdeutschlands. In vielerlei Hinsicht waren wir in einem rechtsfreien Raum unterwegs. Denn das alte Recht galt nicht mehr, und das neue noch nicht in allen Bereichen sofort oder es ließ sich nicht ohne weiteres anwenden.
Klingt alles nach einem ziemlichen Chaos.
Ich will diese Zeit nicht verklären, aber viele Dinge gingen in Wendezeiten deutlich einfacher. Heute läuft natürlich alles viel bürokratischer ab. Ob das Kassablanca nochmal in dieser Form entstehen könnte, glaube ich eher nicht. Heute ist es auch nicht mehr so normal, dass irgendjemand aus irgendeinem Verein beim Bürgermeister oder Dezernenten sitzt und man Dinge auf dem kurzen Dienstweg regelt. Oder dass man sich abends oder am Wochenende noch irgendwo eine Stunde trifft. Man einen Antrag auch mal zurückgibt und sagt: Hört mal, wir wollen das nicht ablehnen, aber das und das müsst ihr da noch reinschreiben, sonst kriegen wir das nicht durch. Es war mühsam, wenn man jungen Menschen, die mit Ideen kamen, sagen musste: So wie ihr euch das vorstellt, geht es nicht.
Aber gefördert worden ist das Kassa von der Stadt immer. Bis heute.
Ja, und das ist gut. Denn die andere Sache ist ja auch, dass man jemanden braucht, der kreativ ist, der Ideen hat, der Angebote entwickelt. Ich habe mich schon immer darüber geärgert, wenn man erstmal über Geld geredet hat. Ich finde, man muss es umgedreht machen. Man braucht erst eine Idee und gegebenenfalls muss man auch Varianten diskutieren und dann kann man berechnen, wie viel das kostet und gucken, wie man das Geld auftreiben kann. Wenn ich von Anfang an über fehlendes Geld rede, dann sind viele Projekte von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Wie würden Sie den Beitrag des Kassa zur Entwicklung der Struktur der Jugendarbeit in Jena einschätzen?
Gerade im Bereich offene Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit hat es einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Beim Kassablanca gab es immer Höhen und Tiefen, das hängt natürlich auch immer von Personen ab. Aber die haben sich nie entmutigen lassen, da gab es immer Menschen die gesagt haben, wir bringen uns ein. Deshalb gibt es das auch immer noch.
Welchen Stellenwert hatte die Jugendarbeit für ihre Kollegen im Stadtrat? Wurde das eher positiv oder kritisch gesehen?
In Jena hatte das sicherlich einen höheren Stellenwert als in vielen anderen Städten und Kreisen. Und das hat sich auch ausgezahlt, denn dadurch haben wir jetzt eine viel vielfältigere Trägerlandschaft. In den Haushaltsberatungen hatte ich immer das Vergnügen, den größten Bereich zu haben – und das waren in der Regel nur Ausgaben. Jugendarbeit oder Kindertagesstätten spielen ja kein Geld ein – die brauchen Geld. Da war es natürlich nicht so, dass die Kollegen immer Hurra geschrien haben, wenn ich meine Zahlen vorgestellt habe. Und was wir auch erst lernen mussten: Man brauchte jetzt für jede Entscheidung eine Mehrheit im Stadtrat.
In den 90er Jahren eskalierte auch in Jena die Gewalt auf der Straße und die Probleme mit dem Rechtsradikalismus. Gab es damals ein Bewusstsein dafür, dass Jugendarbeit eine Lösung ist?
Ich habe häufig mit Kollegen über den Sinn und Zweck von präventiven Maßnahmen diskutieren müssen. Das Problem mit Prävention ist ja, dass sie für sich in Anspruch nimmt, Gewalt zu verhüten – das aber weder garantieren, noch beweisen kann.
Ich würde sagen, die Mehrzahl der Stadträte hatte dafür aber Verständnis. Natürlich wird es immer jemand geben, der sagt: Man hätte noch mehr machen können. Und ja, na klar: Hätte man machen können.
Es gibt ein Foto von Ihnen, da sitzen Sie neben Uwe Mundlos, der später als Mitglied der rechtsextremen Terrorgruppe NSU Menschen ermordete. Wie kam das?
Das ist bei der Eröffnung des Winzerclubs entstanden, einem Jugendklub in Winzerla, der von arbeitslosen Jugendlichen über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme saniert worden war. Welche Jugendliche und welche Anleiter solch einem Projekt zugewiesen worden sind, war durch den Träger der Maßnahme nur sehr begrenzt beeinflussbar. Die endgültige Zuweisung der Personen erfolgt ausschließlich durch die Arbeitsverwaltung.
Sie mussten ja gemeinsam mit anderen Kommunalpolitikern auch im NSU-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag aussagen über mögliche Fehler der Jugendsozialarbeit.
Ich finde, im Nachgang haben es sich einige auch ein bisschen zu einfach gemacht mit ihrer generelle Kritik an der damaligen Jugendsozialarbeit. Retrospektiv und mit dem heutigen Wissen ist Kritik immer einfacher. Damals mussten aber Entscheidungen getroffen werden ohne vollumfängliches Wissen, ohne ausreichend Zeit und immer in Sorge, ob auch die Finanzierung eines Projektes bis zum Abschluss reicht.
Thomas Grund, der es als Sozialarbeiter in Winzerla mit dem späteren NSU zu tun bekam, schreibt: „Ich kam als ABM-Kraft, die man nach der Wende bevorzugt zum Aufbau der Jugendarbeit nutzte, nach Winzerla in ein neu eröffnetes Haus vom Jugendamt. (…) Die Jugendlichen (dir mir dort begegneten) waren die, die nichts mehr wollten, schon vor der Schule das erste Bier kippten und ihren Frust – woher auch immer er stammte – an anderen ausließen. Jugendliche also, die ihr Ding machten und in Ruhe gelassen werden wollten oder Angebote nur annahmen, um ungestört extrem politische Arbeit machen zu können. Kurzum: Fortan hatte ich mit Jugendlichen zu tun, die mit offener Arbeit nichts am Hut hatten, für die jedoch diese offene Arbeit gedacht war. Damals wie heute galt jedoch: Die Umwelt prägt den Menschen und während wir alles gaben, um zehn Leute aus dem Sumpf zu ziehen, schubste die Gesellschaft in der gleichen Zeit 100 neue hinterher.“
An welchen Punkten hätten Sie denn gern anders entschieden im Nachhinein?
Ich halte wenig von hypothetischen Fragen. Eine der großen Diskussionen im Nachgang war ja: Schließt man bestimmte Gruppen aus, oder versucht man sie zu integrieren? Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Generell hatten wir ja eher das Problem, wie wir Jugendliche für die Angebote der Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit begeistern konnten, dass sie sich freiwillig engagierten. Das mit dem Zwang, das hatten wir in der DDR gehabt und waren wir gerade erst los geworden. Mit Integration kann man Erfolg haben, aber es kann eben auch scheitern. Und das hängt nicht nur von den Rahmenbedingungen ab, sondern auch davon, welche Leute eben zufällig an welchem Ort aufeinandertreffen. Das Ausgrenzen ist nicht Aufgabe der Jugendarbeit.

Christian Gesellmann: Das Kassa feierte letztes Jahr seinen 30. Geburtstag! Ein Jahr lang werde ich mich als Stadtschreiber mit den Menschen treffen, die diesen einzigartigen Verein und Club geprägt haben, und ihre Erinnerungen aufschreiben – und natürlich mit Ihnen/dir teilen, hier auf diesem Blog, auf Facebook und Instagram.
Welche Geschichten und Erinnerungen verbinden Sie/verbindest du mit dem Kassablanca? Haben Sie/ hast du noch irgendwo alte Fotos von Ihnen/dir und Ihren/deinen Freunden im Kassa? Ich freue mich auf Post an: allesgute@kassablanca.de
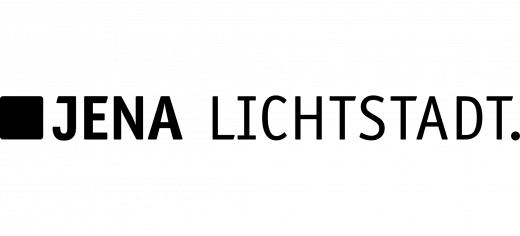

Den Bericht zu „30 Jahre Kassablanca“ und zum Beitrag von Stephan Dorschner dazu habe ich mit großem Interesse gelesen. Allerdings muss ich Folgendes korrigieren:
Am „Runden Tisch“ in Jena im Jenaer Rathaus saß ich für die Katholische Kirche, was in meinen sämtlichen Original-Unterlagen mit den Sitzungsprotokollen auch nachlesbar ist!
Stephan Dorschner saß meines Erachtens am „Runden Tisch des Bezirkes“ in Gera.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Sabine Rübe
Liebe Frau Dr. Rübe,
sollte es sich um einen Fehler der Redaktion handeln, bitten wir dies zu entschuldigen und bedanken uns für die Korrektur.
Viele Grüße
JenaKultur