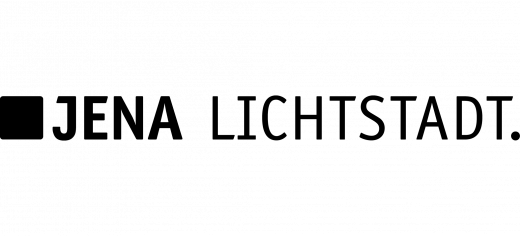Uns hat eine Frage aus einem anderen Bundesland erreicht, die vom Kern her aber auch für solche Länder bedeutsam ist, die – wie der Freistaat Thüringen – keine Straßen(ausbau)beitragserhebung mehr durchführen. Es geht um Folgendes: Anlieger fühlen sich meist als die Leidtragenden, sobald öffentliche Straßen umgebaut werden und ihnen dadurch Beeinträchtigungen bei der Erreichbarkeit entstehen. Im betreffenden Fall betrifft dies Gewerbetreibende, denen Umsatz und Kundschaft verloren gehen / gingen. Die Frage leautet: „Was muss ein Anlieger hierbei noch hinnehmen und ab wann hat er Anspruch auf Schadenersatz?“
Eine öffentliche Straße dient dem Verkehr durch Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Fußgänger etc., wobei sich Zielort und Quelle jedes Verkehrs außerhalb der Straße auf Grundstücken befinden. Die Angewiesenheit dieser Grundstücke auf die öffentliche Straße ist die tatsächliche Voraussetzung für die Teilnahme der Anlieger an deren Gemeingebrauch. Durch Straßenbau- und -ausbaumaßnahmen kommt es regelmäßig zu Beeinträchtigung der Zuwegung, wobei der Bauträger die bedingte Erreichbarkeit (auch durch Rettungs- und/oder Müllfahrzeuge) zu gewährleisten hat. Ohne Frage ist die Erreichbarkeit eines Grundstücks zeitweilig lästig oder beschwerlich, was gerade bei solchen schmerzlich ist, die durch Gewerbetreibende genutzt werden.
Das Bundesverwaltungsgericht und die ihm nachgeordneten Landesgerichte haben in diesem Zusammenhang in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass der Gemeingebrauch an einer Straße insoweit begrenzt ist, dass Anlieger einschränkende Maßnahmen hinnehmen müssen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, die Straße zu bauen, zu erhalten, zu erweitern oder Instand zu halten. Das geht über reine Straßenbauarbeiten hinaus und gilt auch für Arbeiten an Versorgungsleitungen und sonstigen Anlagen, die üblicherweise nicht im Zusammenhang mit der verkehrlichen Nutzung einer Straße stehen – bis hin zum Glasfasernetz der Telekom.
Bedingung ist jedoch, dass der Gemeingebrauch der Anlieger „nicht mehr als erforderlich“, so das BVerwG, eingeschränkt werden darf. Doch auch diese sog. Rücksichtspflicht der Verwaltung hat ihre Grenzen. So sind in der Vergangenheit oft Klagen über die zeitliche Länge von Baumaßnahmen gescheitert, wenn auf der Baustelle zeitweise nicht gearbeitet wurde. Im Umkehrschluss heißt das: Sofern sich die Beeinträchtigungen im Rahmen halten, haben Anlieger sie entschädigungslos – sprich: schadenersatzlos – hinzunehmen. Umsatzrückgänge als Folge von Straßenbauarbeiten, selbst wenn sie über Wochen oder Monate andauern, begründen keinen Entschädigungsanspruch. da sie (Zitat) „zu dem Risiko gehören, das der Gewerbetreibende einzukalkulieren hat.“
Allerdings gibt es weder feste Grenzen für die Dauer von Bauarbeiten, noch Größenordnungen für gerade noch vertretbare Umsatzeinbußen. Maßstab ist und war dabei der wirtschaftlich gesunde Betrieb, der laut Bundesverwaltungsgericht über die Jahre auch Rücklagen für solche Fälle bilden musste und die Situation vieler Gewerbetreibenden durch und nach den Auswirkungen der corona-Pandemie hat meins Wissens nach bisher nicht zu einer grundsätzlichen Änderung der Sichtweise geführt.
Was nicht versäumt werden sollte, ist. dass hiervon betroffene Anlieger bereits in einem frühen Vorfeld der Bauarbeiten von Seiten der Verwaltung auf die eingeschränkte Erreichbarkeit ihrer Grundstücke hingewiesen werden müssen (= Anwohnerinformation), damit diesen die Möglichkeit geboten wird, etwas über entsprechenden Zufahrts-Alternativen während der Bauphase zu erfahren. Leider ist ein Verstoß gegen solche Informationspflichten oft nur eine Ordnungswidrigkeit, weshalb sich eine Stadt oder ihre Verwaltung vom Kern her zwar rechtskonform, wenn auch unter Umständen moralisch betrachtet verwerflich verhält, wenn sie nicht hierüber informiert hat. / RS